
Anmerkungen zu «Je t'aime mélancolie»
von Michael Kuyumcu
|
Auf der „obersten” Ebene geht es für mich in dem Gedicht um die Liebe zu einem Gefühl, das auch ich, wenn’s paßt, zu schätzen weiß: die Melancholie, dieses zuweilen leicht augenfeuchte, bittersüße Schwelgen in Erinnerungen, im Bewußtsein, daß schöne und vergangne Zeiten nie wiederkehren. Übrigens ein Gefühl, bei dem sich mir automatisch die Mundwinkel zu einem leichten, ebenfalls bittersüßen Lächeln nach oben ziehen. Es scheint, als lache ich schon über meinen gefühlsmäßigen „Rückfall”. Manchmal hingegen mag ich die Melancholie nicht so gern: dann scheint mir, als sauge sie mich aus, als sei sie regelrecht ungesund.
Auf der zweiten, im Gedicht ebenfalls explizit erwähnten Ebene geht es um den Kampf von Einzelgängern, die irgendetwas lieben und mit dieser Liebe in scharfen Gegensatz zur Umgebung, in der sie leben, zur Gesellschaft überhaupt, geraten. Ich denke, daß der Text in letzter Konsequenz ein Plädoyer für das Geltenlassen Andersdenkender und -empfindender ist.
„J’ai comme une envie/ De voir ma vie au lit” sind die ersten beiden Verse, und wie der gemeinsame Reim schon andeutet, gehören sie auch inhaltsmäßig zusammen. Grob übersetzt bedeuten sie etwa „Ich habe ein Verlangen/ Mein Leben im Bett (liegend) zu sehn”. Ich kann diese Aussage gut nachempfinden, denn auch mich überfällt die Melancholie gerne, wenn ich im Bett liege, döse und etwas düstere Musik höre. Für mich schwingt in „envie” noch Stärkeres als bloßes Verlangen mit (obwohl Verlangen an sich schon sehr stark sein kann, beim Sex beispielsweise), nämlich ein Gefühl, einer Macht ausgeliefert zu sein, die stärker ist als man selbst, die einen zwingen kann, in einen Gefühlszustand zu geraten, aus dem man nur schwer wieder herausfindet. (Damit dürften auch die Übergänge zur Depression, dem endlosen Kreislauf bis punktförmiger Konzentration seelischer Energie, fließend sein.) Dieses „Verlangen“ ähnelt hier für mein Empfinden einer regelrechten Sucht.
Das Gefühl, dieser Macht ausgeliefert zu sein, verstärkt sich mit den folgenden zwei Versen noch: „Comme une idée fixe”, „Wie eine fixe Idee”, also „Wie eine Zwangsvorstellung” wird das Bedürfnis nach melancholischem Abgleiten empfunden. Das „Chaque fois que l’on me dit” zielt in die gleiche Richtung. Ich glaube, die Autorin möchte damit die Wahrnehmung einer Stimme ausdrücken, die ihr eingibt, sich ins Bett zu legen und über ihr Leben nachzudenken. Für Mylène tut sich dabei anscheinend ein Problem auf („La plaie c’est ca:” – „Die Plage ist dies:”), nämlich, daß „das Unkraut Nacht” einfach zu kurz ist, um ihr Gefühl der Melancholie voll auskosten zu können. Sie schreibt „C’est qu’elle pousse trop vite/ La mauvaise herbe nuit”, also „Es ist, daß es zu schnell drängt/ Das bleiche Unkraut Nacht”, nämlich weiter, zum Ende, zum Morgengrauen hin, das diesem wonniglichen Aufgehen im Gefühl ein Ende macht. Da das Dämmern des neuen Tages nicht zu umgehen ist, überfällt die Autorin, die nicht genug davon bekommen kann, noch ein Schub Selbstmitleid: „C’est là qu’il me vient une idée/ Pouvoir m’apitoyer”, d.h. „Dort kommt mir eine Idee/ Mich selbst bemitleiden zu können”.
Es folgt im Lied nun ein erster Refrain, den man auch als Brücke zur nächsten Strophe ansehen kann. In ihr beschreibt Mylène einen ihrer grundlegenden Wesenszüge, nämlich das Genießen des Leidens, der als süß wahrgenommenen Schmerzen der Melancholie. Sie fühlt sich anscheinend wohl dabei: „C’est bien ma veine/ Je souffre en douce/ J’attends ma peine/ Sa bouche est si douce”, was übersetzt heißt: „Es liegt in meinem Wesen/ Ich leide im Süßen/ Ich erwarte meine Pein/ Ihr Schlund ist so süß”. Hier, finde ich alter Wehmutskenner, verschwimmen die Grenzen von Melancholie und Wehmut.
In der dritten Strophe scheint das Selbstmitleid, das eben noch anklang, schon wieder vergessen. Mylène tröstet sich über die Vergänglichkeit einer einzelnen Nacht hinweg, indem sie erkennt, daß noch viele Nächte, in denen sie ihrer melancholischen Leidenschaft freien Lauf lassen kann, auf sie warten...
Die ersten beiden Verse kennen wir schon aus der ersten Strophe, erledigt. Statt der fixen Idee, der Zwangsvorstellung, schreibt sie nun von einer „idée triste”, also einer traurigen, trostlosen Idee, die sie durch die Nacht verfolgt („Qui me poursuit la nuit”). Das zweifach angehängte „la nuit – la nuit” wirkt äußerst eindrucksvoll, finde ich, als würde sie sich, gequält von dieser trostlosen Idee, von einer Seite unruhig auf die andere wälzen, ohne zur Ruhe kommen zu können. Nach dem vierten Vers folgt ein antithetischer Bruch der Strophe. Jetzt „verfolgt” sie nichts mehr, sondern sie „genießt” die Nacht („Je savoure la nuit”). Eben an dieser Stelle kommen ihr die oben erwähnten tröstlichen Gedanken, daß diese Nacht ja nicht die letzte ist: „L’idée d’éternité/ La mauvaise herbe nuit/ Car elle ne meurt jamais”.
Es folgt des Gedichtes emotionales Kernstück – der Refrain. Es besteht aus zwei Strophen à acht Zeilen. Insgesamt sind die Strophen äußerst kompakt gebaut, und der Bauweise entspricht – o Wunder – auch der Inhalt. Ich habe mich dazu entschlossen, die Titelzeile „Je t’aime mélancolie” unverändert beizubehalten – „mélancolie” ist nicht gleichwertig zu ersetzten, und die restlichen beiden Silben „Je t’aime” sind nicht ohne gravierenden Verlust an Aussage übersetzbar. Im Refrain beschreibt die Autorin ihre Beziehung zur Melancholie, zu Schmerzen und Pein. Sie nennt sie „Freund”, „langen Selbstmord”, „Gefühle, die sie hinabziehen” und „Gemisch aus Verlangen und Schlimmerem”, außerdem als „Elixier ihres Wahnsinns” – farbiger geht’s wohl kaum noch. Vielleicht könnte man die „Schwarzgalligkeit” beschreiben als „Nippen am Wahnsinn”. In der zweiten Strophe des Refrains fallen mir die fünfte und sechste Zeile auf, da sich die Aussage des Gedichtes hier von einer bloßen Beschreibung von Eindrücken löst und zu einer direkten Anrede des Hörers als Gegenüber findet: „Oh vient, je t’en prie/ C’est ton amie aussi”, übersetzt: „Oh komm, ich bitte Dich, gib zu/ Sie ist auch Deine Freundin”. Mit „Sie” ist wieder die Melancholie gemeint. Auffällig die suggestive Art der Aufforderung; sie unterstellt, daß die Liebe zur Melancholie dem Leser ebenfalls eigen ist, er dies aber unter normalen Zuständen nicht zugibt. Das greift schon auf die letzte und vorvorletzte Strophe vor, in denen der Zwiespalt zwischen persönlichem Fühlen und gesellschaftlicher Akzeptanz zur Sprache kommt.
In den folgenden Versen „J’ai comme une envie/ De voir ma vie en l’air” ändert sich die Sichtweise auf das betrachtete Leben: Nicht mehr im Bett, sondern „en l’air”, „in der Luft” wird es gesehen. Offen bleibt an dieser Stelle, ob nun das „Leben“ in die Luft verlegt wird oder die Betrachtungsposition. Diese Doppeldeutigkeit wird im Deutschen mit der Formulierung „in der Luft” erhalten, sozusagen in der Schwebe belassen. An „Schweben” erinnerte mich auch „en l’air“ sogleich, und „Schweben” wiederum im gleichen Atemzug an „Flug”, das ich an dieser Stelle gefühlsmäßig vorziehe, weil es in mir Assoziationen weckt an das Leben, das vorüberzieht, also in allen „Einstellungen“ nacheinander wahrgenommen werden kann.
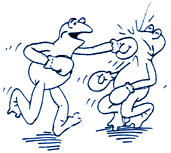 Die letzten fünf Zeilen dieser drittletzten Strophe lenken die Aussage von der im Refrain erschöpfend ausgeführten Beschreibung der Melancholie auf den Konflikt zwischen Empfindender und Außenwelt: „Et moi je dis:/ Qu’une sauvage née/ Vaut bien d’être estimée”, auf deutsch: „Und ich, ich sage/ Daß einer Wildgeborenen/ Die Selbstachtung viel gilt”. Die letzten fünf Zeilen dieser drittletzten Strophe lenken die Aussage von der im Refrain erschöpfend ausgeführten Beschreibung der Melancholie auf den Konflikt zwischen Empfindender und Außenwelt: „Et moi je dis:/ Qu’une sauvage née/ Vaut bien d’être estimée”, auf deutsch: „Und ich, ich sage/ Daß einer Wildgeborenen/ Die Selbstachtung viel gilt”.
Da die Melancholie und das hemmungslose, genießende Versinken in ihr in der Gesellschaft nicht gerade hoch angesehen sind, muß sich die Autorin in der „Richtigkeit” und „Normalität” ihrer Gefühle selbst bestärken. Die Verse klingen so, als würde niemand außerhalb ihrer nächtlichen Welt sie hochachten und als wäre sie gezwungen, sich selbst Mut zu machen, um sich nicht der herrschenden Allgemeinung anzuschließen. Dieses einzelgängerische Element findet sich auch in der letzten Strophe. Ihr Vertrauen in sich scheint ungebrochen. Die beiden folgenden Zeilen lassen Spielraum für die Interpretation: „Après tout elle fait souvent la nique/ Aux »trop bien« cultivées, et toc!”, was auf deutsch, mit der gleichen immanenten Doppeldeutigkeit in etwa heißt: „Nach allem lacht sie oft/ über jene, die »zu gut« kultiviert (sozialisiert) sind, das saß!”. Wer hier mit „sie” gemeint ist, ist nicht klar. Möglich, daß sich die Autorin mit „elle” selbst meint. Diese dissoziierte Aussage wird allerdings durch den bisherigen Text nicht gestützt und kommt auch im weiteren nicht wieder vor. Das Reden von sich selbst in der dritten Person kommt auch eher altertümlichen Adeligen zu, hier macht es für mich keinen Sinn.Wahrscheinlicher ist wohl, daß mit „elle” eben die Melancholie gemeint ist, die im Französischen wie im Deutschen weiblich ist. Somit personifiziert Mylène in diesen Zeilen ein Gefühl und verleiht der Betrachtung eine größere Körperlichkeit und Anschaulichkeit. Die Formulierung „et toc!” deutet auf ein kriegerisches, kämpferisches Umfeld hin, an eine Auseinandersetzung, die sich zuvor schon angedeutet hatte.
An dieser Stelle bietet sich übrigens ein kleiner Abstecher in das Reich der visuellen Unterhaltung, genauer: in das Video zu dem Lied an. In dem Clip tritt Mylène als Kickboxerin gegen einen männlichen Kickboxer an, und synchron zu dem gesungenen „et toc!” erhält dieser einen kräftigen Tritt oder Schlag. Vermutlich symbolisiert der Boxring das Schlachtfeld der Gedanken (möglicherweise auch der unentrinnbaren, dem sich ständig wiederholenden Verlauf der Nacht voller Melancholie) und der männliche Widerpart die Gesellschaft, die mit dem Lied angegriffen und geschlagen werden soll. Daß Mylène beim Refrain zusammen mit einigen anderen weiblichen Tänzerinnen im Ring ein choreographisches Programm absolviert, könnte andeuten, daß sie mit ihrer Einstellung zur Melancholie nicht allein steht.
Nach der ersten Strophe folgt wieder die musikalische Brücke, die zur letzten Strophe überleitet. In dieser ist von Melancholie mit keinem Wort mehr die Rede, sondern von Allgemeinerem. Die Autorin erklärt in ihr ihre Einstellung zur „Moralität”, ein Wort, das schon abschätzigen Klang in sich trägt. Sie bezeichnet die Moralität als eine traurige Idee, die nie stirbt („J’ai comme une envie/ De la moralité/ Comme une idée triste/ Mais qui ne meurt jamais”). Dies klingt bedauernd und anklagend zugleich. Bedauernd, weil der Autorin von der Umwelt kein Respekt entgegengebracht wird, anklagend, weil eine moralinsaure Gesellschaft menschliche Regungen unterdrückt, Menschen unglücklich machen kann und damit Gewalt ausübt. Im übrigen neigen nicht wenige ausdrückliche „Moralisten” zum oberlehrerhaft erhobenen Zeigefinger und einem gewissen Fanatismus bei der Durchsetzung ihrer Vorstellungen, sind also nicht gerade Muster für Toleranz (obwohl sie an ihrer eigenen Beschränktheit des Denkens sicher genug zu tragen, erdulden haben und selbst leiden), und erst recht nicht für gelebtes Geltenlassen.
In den nächsten Zeilen gibt es ein Résumée aus allen Ausführungen: Um den auf ihre weite, eindrucksvolle Gefühlswelt neidischen Mitmenschen zu „gefallen”, müsse man sich tarnen, anpassen, dürfe man sich nicht als gefühlvoll entlarven: „Pour plaire aux jaloux/ Il faut être ignorée”. Die letzten beiden Zeilen holen dann zum kräftigsten verbalen Hieb gegen die Gesellschaft aus, die das Gedicht zu bieten hat: „Mais là, mais là, mais là, pour le coup/ C’est Dieu qui m’a planté, alors?...”.
Gesungen fällt ist in der ersten zitierten Zeile ein Betonungswechsel auf. In den ersten beiden „mais là” liegt die sprachliche Betonung auf „là”, dann wechselt sie auf „mais” und gibt den letzten, folgenden Wörtern ungeahnte Durchschlagskraft: „...dieser Hieb:/ War doch Gott, der mich erschuf, also?...”.
Mit der letzten Zeile, der Pointe quasi, werden die Moralisten der Gesellschaft mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Die Aussage lautet: Wenn Ihr, die Ihr der Moralität anhängt, mich kritisiert, mich nicht achtet, dann achtet Ihr Gott nicht, denn Gott hat mich erschaffen, wie Euch auch. Die Nichtachtung Gottes allerdings verstößt gegen Eure eigenen Moralitäts-Grundsätze, ist Gotteslästerung.
Nachzutragen bleibt mir in diesem Zusammenhang nur noch, daß eine ähnliche Argumentation früher „Hexen” nicht davor bewahrt hat, verbrannt zu werden. Aber heute sind halt für Menschenverbrennungen die Genehmigungen viel schwieriger zu bekommen…
|
|

